Papers by Mirna Zeman
Mit Automatismen zwangslaufig verbunden ist die Frage nach dem Selbst und nach den Bedingungen, d... more Mit Automatismen zwangslaufig verbunden ist die Frage nach dem Selbst und nach den Bedingungen, die es hervorbringen. Automatismen setzen ein ›Selbst‹ einerseits voraus, andererseits ist zu fragen, ...

Der Begriff ‚Zyklographie' (etymolog. von griech. ‚Kyklos' = ,Kreis' über latein. ‚cyclo-' = ‚kre... more Der Begriff ‚Zyklographie' (etymolog. von griech. ‚Kyklos' = ,Kreis' über latein. ‚cyclo-' = ‚kreisförmig' und griech. ‚graphein' = ‚schreiben') geht auf die Bezeichnung für verschiedene Instrumente zur Routenaufnahme und Aufzeichnung der Bewegungsabläufe von Menschen und Objekten zurück. 1 Thomas Ferguson hat um 1900 ein Instrument erfunden, das ein mobiles Objekt zur automatischen Aufnahme seines Weges befähigt und nannte dieses Instrument Zyklograph: Der Zyklograph besorgt die selbsttätige Aufnahme des Weges, den ein Instrument tragendes Fahrzeug zurücklegt. Es ist besonders zur Anwendung auf dem Fahrrad bestimmt, kann aber auch über dem Rade eines andern Fuhrwerks angebracht werden. 2 31 Vgl. den Beitrag von Kerstin Kraft im vorliegenden Band. 32 Vgl. den Beitrag von Peter Braun im vorliegenden Band. 33 Buchwissenschaftler_innen modellieren die Prozesse der Produktion, Distribution und Rezeption von bibliographischen Objekten als Zyklen. Robert Darntons Modell etwa sieht einen Kommunikationszirkel vor, der von Autor zu Verleger, Drucker, Versand, Buchhandel und Leser verläuft. Der Zyklus fängt in diesem Modell beim Leser an und kehrt bei diesem zu sich zurück. Ein alternatives Modell von Adams und Barker kehrt die Perspektive um und schlägt einen Lebenszyklus aus der Sicht des Gegenstandes vor, der die Abfolge der Phasen publishing, manufacturing, distribution, reception und survival durchläuft. Siehe Robert Darnton: "Was ist die Geschichte des Buches", in: ders. (Hg.
Doing Contemporary Literature, 2012

Umjetnost riječi, 2022
U radu se predstavlja korpus tekstova na njemačkom jeziku u kojima stvari u modusu fikcije, uglav... more U radu se predstavlja korpus tekstova na njemačkom jeziku u kojima stvari u modusu fikcije, uglavnom u ja-formi, pripovijedaju vlastite "životne" priče. Budući da dotične tekstove nije moguće jednoznačno žanrovski odrediti, posebna se pažnja posvećuje dosadašnjim problematiziranjima žanra, pokušajima njegova teorijskog određivanja i kontekstualizaciji njemačkih primjera unutar svjetske književnosti. Kao izlaz iz terminološke zbrke predlaže se naziv životo(puto)pisi, odnosno autociklografije stvari za njihovu moguću identifikacijsku oznaku. Drugi dio rada donosi podrobniju analizu Grimmelshausenova životo(puto) pisa toaletnog papira, a u pregledu su predstavljene autociklografije stvari iz njemačke književnosti 18. i 19. stoljeća, tj. tekstovi u kojima kovanica, perika, muha, knjiga, kočija za najam, čačkalica, vic i želudac pripovijedaju o vlastitim životnim zgodama. Ključne riječi: poetika stvari, (auto)biografije stvari, autociklografija/ životo(puto)pisi stvari, it-narratives/novels of circulation
Jessica Güsken, Christian Lück, Wim Peeters, Peter Risthaus (Hg.):Konformieren: Festschrift für Michael Niehaus , 2019
Kürzlich sah ich in einem Dokumentarfilm«, schreibt Dubravka Ugrešić, »wie der westliche Markt Ne... more Kürzlich sah ich in einem Dokumentarfilm«, schreibt Dubravka Ugrešić, »wie der westliche Markt Neu-Guinea zu erobern versucht. Die Marktinstrukteure erklärten den fröhlichen Papuas wie in einem Pantomimentheater, was Coca Cola ist und wozu das Waschpulver ›Omo‹ dient. Die Papuas wälzten sich vor Lachen. Und ich lachte mit.« 1
Träumer sind, sagt uns Freud, unausstehlich witzig…
Die enge Verflechtung von Kultur und Ökonomie, die Vorherrschaft einer "Ökonomie der Zeichen" und... more Die enge Verflechtung von Kultur und Ökonomie, die Vorherrschaft einer "Ökonomie der Zeichen" und die wechselseitige Durchdringung des Lokalen und Globalen in der heutigen Zeit bestätigen sich sehr anschaulich in den Praktiken des Standortmarketings und Nation Branding. 1 In vielen Ländern der Welt wurden im letzten Jahrzehnt Projekte der Ländervermarktung gestartet, die auf eine neuartige Weise Kulturgüter in Wirtschaftsfaktoren konvertieren und skurrile Verknüpfungen zwischen dem Symbolischen und Ökonomischen hervorbringen.

Ruthner. In einer Erklärungsnot befindet sich auch die neuere Imagologie, etwa bezüglich der m.E.... more Ruthner. In einer Erklärungsnot befindet sich auch die neuere Imagologie, etwa bezüglich der m.E. durchaus berechtigten Kritik an dem imagologischen Bildbegriff und der Unterscheidung von literarischen Auto-und Heterostereotypen, die in der neueren Zeit u.a. von Ruth Florack geäußert wurde. Florack wirft der Imagologie vor, die besondere Textstrategie, die den Stereotypengebrauch in einem Text steuert -etwa die satirische oder polemische Funktion von Nationalstereotypen, bei der es gar nicht um die Darstellung einer fremden Kultur geht -zu vernachlässigen. Die Imagologie totalisiere die einzelnen Muster zu einem Bild und unterstelle außerdem, dass "diese ‚Bilder' auf Vorstellungen, ja auf (affektive) Einstellungen schließen lassen, die ein Autor dem je besonderen Fremden gegenüber hegen soll. Texte sind aber keine Bewußtseinsprotokolle, folgen eigenen, rhetorischen und ästhetischen Gesetzmäßigkeiten." Eine Unterscheidung von literarischen Selbst-und Fremdbildern hält Florack für unhaltbar: "Wenn die Literatur eines Landesdie es im Singular ohnehin nicht gibt -die Einstellungen seiner Bewohner gegenüber ‚sich selbst' und ‚dem Anderen' spiegeln soll, wenn gar Literaturen zweier Länder dialogisch aufeinander reagieren, miteinander kommunizieren sollen, so wird die alte anthropomorphisierende Vorstellung von dem Volk bzw. der Nation als einem Kollektivsubjekt (das sich in der jeweiligen Nationalliteratur äußere) unreflektiert fortgeschrieben." (Florack, 38). Ein Hinweis auf den gangbaren Ausweg aus diesen methodischen Schwierigkeiten ist in einer Formulierung Leerssens implizite enthalten: "One of the most complex issue an imagologist can face is the question, not about whom but for whom does a text speak?" (Leerssen, 338). Anstatt also vorschnell von "spectant-nations" als einem monolithischen Subjekt der Imageproduktion auszugehen, würde es sich lohnen, diese komplexe Frage ernst zu nehmen und stereotype Aussagen eines Textes im Zusammenhang mit der diskursiven Positionierung des jeweils individuellen "spectant" zur Kollektivität (die sich etwa in Form von Solidarität mit einer sozialen, nationalen, konfessionellen, supranationalen, geschlechtlichen etc. Form von Kollektivität oder auch als Ablehnung des sozialen Zwangs zu einer jeglichen kollektiven Identität äußern kann), genauer unter die Lupe zu nehmen. Außerdem empfiehlt sich eine Annäherung der Imagologie an die Forschungsausrichtungen, die sich mit generativen Mechanismen der Stereotypenbildung -etwa mit dem interdiskursiven Spiel der Distinktionen, dem Mechanismus der Wiederholung oder den Prozessen der Konventionalisierung und der Schemabildung -beschäftigen. Vgl. dazu u.a. Link/Wülfing [Hg.], Nationale Mythen; Dies. [Hg.], Bewegung und Stillstand; Siehe auch Conradi et al. [Hg.
Monographs/Edited Volumes by Mirna Zeman








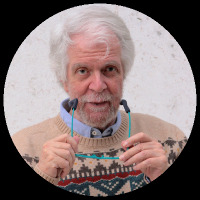


Uploads
Papers by Mirna Zeman
Monographs/Edited Volumes by Mirna Zeman