Papers by Brigitte Dalinger

Ergebnisse einer "Suche in einem Scherbenhaufen". - Zum "Handbuch des deutschsprac... more Ergebnisse einer "Suche in einem Scherbenhaufen". - Zum "Handbuch des deutschsprachigen Exiltheaters 1933–1945" Im Frühjahr dieses Jahres erschien im Münchner K.G. Saur Verlag das umfangreiche Handbuch des deutschsprachigen Exiltheaters 1933-1945, herausgegeben von Frithjof Trapp, Werner Mittenzwei, Henning Rischbieter und Hansjörg Schneider. Das Handbuch besteht aus zwei Teilen, die in drei Bänden vorliegen. Der erste Teil (und 1. Band) trägt den Titel Verfolgung und Exil deutschsprachiger Theaterkünstler, der zweite Teil ist ein Biographisches Lexikon der Theaterkünstler, das zwei Teilbände umfaßt und rund 4000 Biographien enthält Die Idee zu einem Buch über deutschsprachiges Exiltheater entstand schon Anfang der siebziger Jahre an der "Hamburger Arbeitsstelle für deutsche Exilliteratur"; unter völlig veränderten politischen Bedingungen wurde sie 1990, anläßlich einer Tagung in Hamburg, wieder aufgenommen. Im Gegensatz zu früheren Arbeiten über Exilth...

Im vorliegenden Buch gibt Heidelore Riss einen Überblick über die jüdischen Theateraktivitäten, d... more Im vorliegenden Buch gibt Heidelore Riss einen Überblick über die jüdischen Theateraktivitäten, die in den Jahren 1889 bis 1933 in Berlin stattgefunden haben; darüber hinaus beschreibt sie die Folgen der "Machtübernahme" der Nationalsozialisten im Jänner 1933 auf die deutschen Theater sowie die Gründung und die Aufgaben des Kulturbundes Deutscher Juden. In der Einleitung weist die Autorin auf die schwierige Quellenlage zu diesem bis jetzt vernachlässigten Teil der Theatergeschichte hin. Kurz werden die unterschiedliche Entwicklung des deutschen bzw. osteuropäischen Judentums umrissen und die Entstehung des "Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" besprochen, der die Juden in Deutschland sammeln, in der "Pflege deutscher Gesinnung" stärken und gegen Antisemitismus gezielt vorgehen sollte. Einen völlig anderen kulturellen Hintergrund und Anspruch als die "deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens" hatten die osteuropäischen Zuw...

Am Beginn seines Buches beschreibt Michael Brenner das geläufige Bild der Juden in der Weimarer R... more Am Beginn seines Buches beschreibt Michael Brenner das geläufige Bild der Juden in der Weimarer Republik: das Bild von "Juden ohne Judentum", von Juden, die einerseits die Kultur der Weimarer Zeit entscheidend mitprägten, andererseits keine Bindung zu ihrem Judentum und dessen Kultur hatten. Im Buch wird dieses Bild revidiert. Im ersten Teil, betitelt - Auf der Suche nach Gemeinschaft - beschreibt der Autor die Änderungen im Leben der Juden im 19. Jahrhundert, die Befreiung aus der Enge der Ghetti, die zunehmende Rezeption von weltlichem Wissen und deutscher Literatur, die dazu führten, daß das Judentum mehr und mehr auf eine Konfession reduziert wurde. Der jüdische Alltag wurde immer weniger von den Geboten der jüdischen Gesetze geprägt, die Zuordnung zum Judentum war auf den Synagogenbesuch beschränkt. Brenner: "Einhergehend mit diesem Prozeß der Konfessionalisierung schufen deutsche Juden säkulare Kulturformen, um ihre jüdische Eigentümlichkeit auszudrücken. [...] ...
Rezens.tfm, Apr 16, 2021
von Brigitte Dalinger Während des Ersten Weltkriegs gab es in Wien eine florierende Unterhaltungs... more von Brigitte Dalinger Während des Ersten Weltkriegs gab es in Wien eine florierende Unterhaltungsszene, in der Operetten, Singspiele, Revuen und Kabarettrevuen aufgeführt wurden, mit einer "tendenzielle[n] Aufhebung der Genregrenzen" (S. 15). Gespielt wurde in Theatern, Kabaretts und Restaurants, geboten wurden, vor al
Rezens.tfm, Apr 16, 2021
von Brigitte Dalinger 2002 wurde im Steppenwolf Theatre in Chicago Maria Arndt: A Play in Five Ac... more von Brigitte Dalinger 2002 wurde im Steppenwolf Theatre in Chicago Maria Arndt: A Play in Five Acts von Elsa Porges-Bernstein in der Übersetzung von Susanne Kord inszeniert. Ein Stück, das 1908 im renommierten Fischer Verlag erschienen und im gleichen Jahr in München uraufgeführt worden war. Im deutschen Sprachraum blieb es seit den frühen 1910er Jahren still um die Bühnenstücke der heute fast vergessenen Elsa Bernstein (1866-1949), die unter dem Pseudonym Ernst Rosmer publizierte. Wie kam es zur englischsprachigen Aufführung eines ihrer Dramen in Chicago? Auskunft auf diese Frage gibt der von Helga W. Kraft und Dagmar C. G. Lorenz verfasste einleitende Essay "A Writer Beyond Nation and Time", in dem
Bibliotheken und Sammlungen im Exil, 2011

Die literarische Gattung des Buhnenschwankes war in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ... more Die literarische Gattung des Buhnenschwankes war in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts eine der popularsten Buhnenformen uberhaupt, in Deutschland wurden "wahrend der Spielzeiten 1879/80 bis 1930/31 mindestens 1250 abendfullende Schwanke" ur- und erstaufgefuhrt, wie Herausgeber Helmut Schmiedt in der Einleitung darlegt. Popular blieb der Schwank bis zur Weltwirtschaftskrise 1930 - erst mit dem Niedergang der okonomischen Basis der mittelstandisch-burgerlichen Familie, der bevorzugten Spielgrundlage dieser Buhnenstucke, verloren sie an Popularitat, ohne sie jedoch vollstandig einzubusen. In den 50er Jahren waren sie immerhin noch so beliebt, das die erfolgreichsten verfilmt wurden: Der Raub der Sabinerinnen (UA 1884) von Franz und Paul von Schonthan wurde 1953/54 von Kurt Hoffmann verfilmt, am Drehbuch arbeitete u.a. Johannes Mario Simmel mit; Pension Scholler (UA 1890), verfast von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby, w...

Der Hauptteil von Joel Berkowitz' Buch besteht aus funf Kapiteln, deren jeweilige Uberschrift... more Der Hauptteil von Joel Berkowitz' Buch besteht aus funf Kapiteln, deren jeweilige Uberschriften zeigen, welche Dramen Shakespeares auf dem amerikanisch-jiddischen Theater besonders einflusreich waren. 1. "Gordin Is Greater Than Shakespeare": The Jewish King and Queen Lear. Jacob Gordin begann um 1890 in New York, das jiddische Theater zu reformieren, indem er (seiner Zeit und Umgebung entsprechende) anspruchsvolle Theaterstucke schrieb und gegenuber den Schauspielern und Theaterdirektoren darauf bestand, das seine Texte moglichst unverandert und ohne Beigaben schwungvoller Lieder oder ahnlichem gesprochen wurden. Vorbild vieler seiner Theaterstucke waren Stoffe aus der Weltliteratur, von den Dramen Shakespeares hatte es ihm besonders King Lear angetan. So entstanden Der yidisher kenig Lir (UA 1892) und Di yidishe kenigin Lir oder Mirele Efros (UA 1898), beides Theaterstucke, die jahrzehntelang im Repertoire jiddischer Buhnen blieben bzw. wie Mirele Efros heute noch ges...

Laut Angaben des Autors Ralf Kurtze verfolgte das vorliegende Buch drei Ziele: die Darstellung de... more Laut Angaben des Autors Ralf Kurtze verfolgte das vorliegende Buch drei Ziele: die Darstellung des Lebens und Wirkens des Schauspielers Jizchak Lowy, der aufgrund seiner Freundschaft mit Franz Kafka und dessen Beschreibungen seiner Schauspielkunst zumindest Kafka-Kennern ein Begriff ist; weiters die Darstellung des polizeilichen Zensurwesens in Preusen um die Jahrhundertwende und den Vergleich zwischen den Original- und Zensurfassungen zweier ausgewahlter jiddischer Theaterstucke, Sulamith von Abraham Goldfaden und Die Sedernacht von Joseph Lateiner. Die Ausfuhrungen Kurtzes zum jiddischen und (deutschsprachigen) judischen Theater in Berlin um die Jahrhundertwende folgen weitgehend den Buchern von Peter Sprengel (Scheunenviertel-Theater, erschienen 1995 in Berlin, und Populares judisches Theater in Berlin von 1877 bis 1933, erschienen 1997 ebendort). Neues uber diese judischen Theateraktivitaten ist nicht auszumachen. Zu Lowys Biographie zitiert Kurtze vor allem aus den Lowy gewid...

The German Quarterly, 2008
Kraft, Helga W., and Dagmar C. Lorenz, eds. From Fin-de-Siecle to Theresienstadt: The Works and L... more Kraft, Helga W., and Dagmar C. Lorenz, eds. From Fin-de-Siecle to Theresienstadt: The Works and Life of the Writer Elsa Porges-Bernstein. New York: Feter Lang, 2007. 260 pp. euro65.90 hardcover. 2002 wurde im Steppenwolf Theatre in Chicago Maria Arndt: A Play in Five Acts von Elsa Fbrges-Bernstein in der Ubersetzung von Susanne Kord inszeniert, ein Stuck, das 1908 im renommierten Fischer Verlag erschienen ist und im gleichen Jahr in Munchen uraufgefuhrt worden war. Im deutschen Sprachraum blieb es seit den fruhen 1910er Jahren still um die Buhnenstucke der heute fast vergessenen Elsa Bernstein (1866-1949), die unter dem Pseudonym Ernst Rosmer publizierte. Wie kam es zur Auffuhrung eines ihrer Dramen in Chicago, in englischer Ubersetzung? Auskunft zu dieser Frage gibt der einleitende Essay "A Writer Beyond Nation and Time" von Helga W Kraft und Dagmar C. C. Lorenz, in dem die fehlende Rezeption sowie wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Autorin respektive ihrem W...

Carl Carl (eigentlich: Carl Andreas Bernbrunn, 1787?-1854), Schauspieler und ebenso langjahriger ... more Carl Carl (eigentlich: Carl Andreas Bernbrunn, 1787?-1854), Schauspieler und ebenso langjahriger wie umstrittener Theaterdirektor in Munchen und Wien, seine Frau Margaretha Lang (1788-1861), eine beliebte Munchner Hofschauspielerin, die in Wien von der Buhne zuruckgezogen lebte, und die Schauspielerin und spater sehr erfolgreiche Dramatikerin Charlotte Birch-Pfeiffer (1880-1868) lernten einander am Munchner Isartortheater kennen. Carl hatte sich an diesem 1812 eroffneten Volkstheater rasch als Schauspieler und Regisseur etablieren konnen, war zum Hofschauspieler avanciert und heiratete 1813 die Opernsangerin und Hofschauspielerin Margaretha Lang. Im selben Jahr lernten die beiden Charlotte Birch kennen, die im Alter von 13 Jahren ihr Buhnendebut am Isartortheater gegeben hatte und schon als Funfzehnjahrige in der Rolle der Johanna von Orleans zu sehen gewesen war. Neben ihrem festen Engagement von 1819 bis 1826 am Koniglichen Hoftheater in Munchen unternahm die junge Schauspielerin ...

Sehr genau setzt sich Christina Jung-Hofmann in der vorliegenden Arbeit, die 1997 als Dissertatio... more Sehr genau setzt sich Christina Jung-Hofmann in der vorliegenden Arbeit, die 1997 als Dissertation an der Johannes Gutenberg-Universitat Mainz entstand, mit dem Begriff und der Programmatik des Zeitstuckes in der Weimarer Republik auseinander. In der Einleitung legt die Autorin die Definition von Kunst seitens namhafter Autoren - Theodor W. Adorno, Peter Szondi - dar, und schreibt, das sie den Versuch unternehmen werde, "im Sinne Adornos Zeitstucke als Kunstwerke zu verstehen". "Bewust wird darauf verzichtet, eine formale und inhaltliche Begriffsbestimmung des Zeitstuckes am Anfang zu geben; ebenso wird darauf verzichtet, einen normativen Realismusbegriff vorauszusetzen, obwohl das Zeitstuck seiner allgemeinen Charakteristika wegen dem Realismus zugeordnet werden mus." (S. 16) Wie Jung-Hofmann erlautert, zielt ihr Ansatz "auf die Darstellung grundsatzlicher struktureller Moglichkeiten des Zeitstuckes." (S. 18) Als Ausgangsbasis ihrer Arbeit beruft sie s...


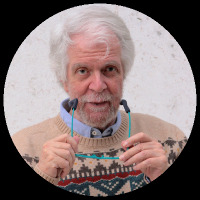



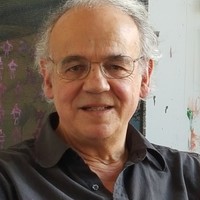



Uploads
Papers by Brigitte Dalinger