
Joerg Hartmann
Joerg Hartmann is a Phd candidate at Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany, where he received his Master’s degree in German Literature/Media Studies.
In his dissertation project ‘Spaceship with Spectator’ he further pursues Hans Blumenberg’s philosophy to illustrate how science fiction films from Méliès (1902) to Scott (2012) can be seen as ‘re-occupation’ of one of mankind’s oldest spatial metaphors, life as a sea fare voyage.
Joerg’s research interests include history of ideas as well as film studies, spectatorship, and science fiction.
He is an active member of two scientific groups in which he discusses his findings: Formatting of Social Space (KIT), and Concepts of Space 1600/1900 (Forum Scientiarum, University of Tuebingen).
Before he went to Yale as Visiting Assistant (February - July 2012) he taught graduate courses at the KIT on Theories of Media Culture, Space- and Time Travel in Science Fiction Films, and on Figurative Speech.
His most recent publication is ‚Der erste Raumschiffbruch der Filmgeschichte: G. Méliès Filme metaphorologisch betrachtet.‘ In: Schmeink/Mueller (Hg.): Fremde Welten: Wege und Räume der Fantastik im 21. Jahrhundert. Berlin: De Gruyter, 2012.
In his dissertation project ‘Spaceship with Spectator’ he further pursues Hans Blumenberg’s philosophy to illustrate how science fiction films from Méliès (1902) to Scott (2012) can be seen as ‘re-occupation’ of one of mankind’s oldest spatial metaphors, life as a sea fare voyage.
Joerg’s research interests include history of ideas as well as film studies, spectatorship, and science fiction.
He is an active member of two scientific groups in which he discusses his findings: Formatting of Social Space (KIT), and Concepts of Space 1600/1900 (Forum Scientiarum, University of Tuebingen).
Before he went to Yale as Visiting Assistant (February - July 2012) he taught graduate courses at the KIT on Theories of Media Culture, Space- and Time Travel in Science Fiction Films, and on Figurative Speech.
His most recent publication is ‚Der erste Raumschiffbruch der Filmgeschichte: G. Méliès Filme metaphorologisch betrachtet.‘ In: Schmeink/Mueller (Hg.): Fremde Welten: Wege und Räume der Fantastik im 21. Jahrhundert. Berlin: De Gruyter, 2012.
less
Related Authors
Daniel Brandau
Universität Bielefeld
Alexander C . T . Geppert
New York University
Viktor Konitzer
Universität Konstanz
sven grampp
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Constanze Seifert-Hartz
Freie Universität Berlin
Jana Bruggmann
Freie Universität Berlin
Sven Gross
Hochschule Harz
Dierk Spreen
Berlin School of Economics and Law
Joachim Fischer
Technische Universität Dresden
Jørg Himmelreich
Swiss Federal Institute of Technology (ETH)








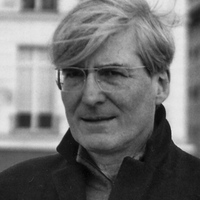
Uploads
Papers by Joerg Hartmann
Der vorliegende Text vertieft diese Verquickung auf der Grundlage einer vergleichenden Analyse von Johannes Keplers Somnium (1634) und Georges Méliès La Lune à un mètre (1898). Beiden Werken gemein ist, dass sie von Astronomen geträumte Mondreisen schildern, unterschiedlich sind jedoch die topologischen Kontexte ihrer jeweiligen Entstehungszeit und damit die historisch bedingte Raumwahrnehmung: Kepler schreibt seinen Text auf der Schwelle des Wandels vom geo- zum heliozentrischen Weltbild um 1600, Méliès dreht seinen Stummfilm in der Metropole Paris um 1900.
Welche Erkenntnisse hinsichtlich des Wandels von Raumkonzeptionen birgt die Gegenüberstellung dieser künstlerisch inszenierten Mondreiseträume von 1600 einerseits und 1900 andererseits? Im Hinblick auf diese Fragestellung werden im Folgenden die Gemeinsamkeiten, Gegensätze und Kontinuitäten sowie die epochenspezifischen Raumwahrnehmungen herausgearbeitet und zueinander in Bezug gesetzt.
Der abschließende Teil stellt die historische Wirkung künstlerischer und dokumentarischer Traumdarstellungen dar. Hierfür nimmt er die erste vom Mond aus fotografierte Aufnahme der Erdkugel in den Blick. Belichtet im Jahr 1968 hält das Bild den Moment fest, in dem an die Stelle künstlerischer Traumwelten die optisch vermittelte Raumwahrnehmung astronautischer Wirklichkeit getreten ist.
Ein Experiment mit dieser neuen medialen Form, um den klassischen Literaturbegriff zu dehnen, zu zerren und ihn schließlich doch noch ins zeitgenössische Format aus maximal 140 Zeichen hinüberzuretten.
Die Analyse des rasanten Wandels zeitgenössischer Textproduktion, -vermittlung und -rezeption bildete dabei das Fundament für diese avantgardistische Literaturproduktion, die kein Papier mehr braucht. Buchleser geschockt? Smartphones und Tablets willkommen!
„Was getwittert wird, ist nächste Literatur, weil hier lesend und schreibend mit Geräten experimentiert wird, die zu den Leitmedien der Gegenwart geworden sind. (…). Sie sind die Treibsätze einer Kultur, die sich immer mehr für das nächste große Ding interessiert, die Vergangenheit entwertet und dabei vor der Gegenwart nicht Halt macht.
Den Texten ist diese Bewegung auf das Nächste eingeschrieben. Die Beschränkung auf hundertvierzig Zeichen macht klar: Niemand will hier bei irgendetwas lange verweilen. Kann man auch gar nicht. Die nächsten Tweets werden in der Timeline längst weiter draufgestapelt.
Ein Tweet (…) markiert nicht das Ende. Er ist das Material für die nächsten Ideen.“ - S. Porombka, Die nächste Literatur. Anmerkungen zum Twittern.
Die Übung ‘Experimentelles Schreiben‘ bietet die Möglichkeit, von der Rolle der Analysierenden hinüberzuwechseln in die Rolle der text-produzierenden ‚KünstlerInnen‘: unter Anleitung werden eigene, experimentelle Texte verfasst, vorgestellt und diskutiert.
Die selbständige literarische Arbeit liefert dem Gespür für die spezifische Machart von Texten neue Impulse. Aus praktischer Perspektive wird entdeckt „dass Gedichte, Romane oder Novellen keine spontanen, mehr oder weniger unüberlegten Einfälle eines Autors sind, sondern durchkomponierte Strukturen aufweisen.“ (Leis 2012, S. 7).
Neben der generellen Fähigkeit, sich auszudrücken, wird somit auch das Vertrauen in die eigene theoretisierende Einschätzung von Literatur gestärkt. Die Übung besteht aus drei Einheiten, wovon einige abends in Karlsruher Museen stattfinden
Bei der Darstellung seines Projekts bedient sich auch Blumenberg verschiedener, bestimmte Erwartungshorizonte eröffnender Metaphern. Damit konnte der ‚Paradigmen‘-Text selbst zur Erprobung seiner Methodik als Gegenstand metaphorologischer Analysen dienen. So untersuchte Dirk Mende das darin implizit zur Sprache kommende Verhältnis zwischen Begriffsgeschichte und Metaphorologie, Rüdiger Campe widmete sich der zentralen Bedeutung der ‚Halbzeugs‘-Metapher für das Umspringen des thematischen Interesses Blumenbergs von Technikphilosophie zu Rhetorik.
Ab 1971 weitet Blumenberg jedoch seinen Ansatz aus: die Metapher stellt ab den Anthropologischen Annäherungen an die Rhetorik nur noch einen Spezialfall unter weiteren Formen der "Unbegrifflichkeit" dar. Des Weiteren fokussiert sich Blumenberg nicht mehr auf die Genese von Begrifflichkeiten, nun deckt er die „rückwärtigen Verbindungen“ der Metapher zur Lebenswelt auf. Mit diesem Perspektivwechsel ändert sich nicht nur die Funktion der Metapher, auch die Metaphorik innerhalb der Theorie Blumenbergs wechselt.
Die Untersuchung der damit vorgenommenen Weichenstellungen steht bisher noch aus. Ich schlage daher eine Fortsetzung der oben genannten meta-metaphorologischen Analysen vor. Angewandt auf Blumenbergs 1979 veröffentlichten Ausblick auf eine Theorie der Unbegrifflichkeit, wird damit zunächst die spezifische Frage, was es war, was Blumenberg wissen wollte, beantwortet. Daran anschließend kann in die allgemeinere Diskussion übergegangen werden: Was kann es sein, was wir aufgrund der jeweils verwendeten Metaphoriken auch auf weiteren, kulturwissenschaftlichen Gebieten erfahren können?
As a result rethinking the way they raise money is critical for their survival. It requires that nonprofits become more innovative and strategic in the way they use visuals. Selling balloons does not work anymore... .
Kategoriale, generische und mediale Transgressionen in Ridley Scotts ‚Prometheus‘ als Arbeit am Mythos.
Die Urerzählung grenzüberschreitender Rebellion lässt sich seit der griechischen Antike im Prometheus-Mythos finden. Mit dem 2011 in die Kinos gekommenen Prequel zur Alien-Reihe fügt Ridley Scott der Tradierung dieses Stoffes ein weiteres Kapitel hinzu.
Gemäß der These des deutschen Philosophen Hans Blumenberg, dass Mythen Geschichten von hochgradiger Beständigkeit ihres narrativen Kerns und ebenso ausgeprägter marginaler Variationsfähigkeit seien, aktualisiert Scott mit einer solchen „Arbeit am Mythos“ die mit dem Stoff verbundenen, seit der griechischen Antike immer wieder ähnlich und doch immer wieder neu erzählten Welt- und Selbstbildentwürfe des westlichen Kulturkreises.
Erst einmal nur des Titels wegen steht Scott in einer Reihe mit Aischylos, Goethe, Shelley und vielen weiteren Kunstschaffenden - doch welche Elemente der Basiserzählung greift er tatsächlich auf? Wie variiert er sie und schafft daraus ein Zukunftsnarrativ mit einem neuen, für die Gegenwart bedeutsamen Interpretationsrahmen?
Der Film, als Machwerk zwischen tiefsinnigem Autorenfilm und effektbeladenem B-Movie in der Kritik stark umstritten, liefert zur Beantwortung dieser Fragen reichlich Potential.
Mein Beitrag arbeitet zunächst die im Film gezeigten kategorialen Grenzüberschreitungen zwischen Menschen und menschenerschaffenden Außerirdischen sowie ihrer algorithmischen Fesseln entbundenen Androiden heraus, verortet diese dann historisch und schließt mit einer, der Analyse gefundener Transgressionen folgenden Interpretation.
Der vorliegende Text vertieft diese Verquickung auf der Grundlage einer vergleichenden Analyse von Johannes Keplers Somnium (1634) und Georges Méliès La Lune à un mètre (1898). Beiden Werken gemein ist, dass sie von Astronomen geträumte Mondreisen schildern, unterschiedlich sind jedoch die topologischen Kontexte ihrer jeweiligen Entstehungszeit und damit die historisch bedingte Raumwahrnehmung: Kepler schreibt seinen Text auf der Schwelle des Wandels vom geo- zum heliozentrischen Weltbild um 1600, Méliès dreht seinen Stummfilm in der Metropole Paris um 1900.
Welche Erkenntnisse hinsichtlich des Wandels von Raumkonzeptionen birgt die Gegenüberstellung dieser künstlerisch inszenierten Mondreiseträume von 1600 einerseits und 1900 andererseits? Im Hinblick auf diese Fragestellung werden im Folgenden die Gemeinsamkeiten, Gegensätze und Kontinuitäten sowie die epochenspezifischen Raumwahrnehmungen herausgearbeitet und zueinander in Bezug gesetzt.
Der abschließende Teil stellt die historische Wirkung künstlerischer und dokumentarischer Traumdarstellungen dar. Hierfür nimmt er die erste vom Mond aus fotografierte Aufnahme der Erdkugel in den Blick. Belichtet im Jahr 1968 hält das Bild den Moment fest, in dem an die Stelle künstlerischer Traumwelten die optisch vermittelte Raumwahrnehmung astronautischer Wirklichkeit getreten ist.
Ein Experiment mit dieser neuen medialen Form, um den klassischen Literaturbegriff zu dehnen, zu zerren und ihn schließlich doch noch ins zeitgenössische Format aus maximal 140 Zeichen hinüberzuretten.
Die Analyse des rasanten Wandels zeitgenössischer Textproduktion, -vermittlung und -rezeption bildete dabei das Fundament für diese avantgardistische Literaturproduktion, die kein Papier mehr braucht. Buchleser geschockt? Smartphones und Tablets willkommen!
„Was getwittert wird, ist nächste Literatur, weil hier lesend und schreibend mit Geräten experimentiert wird, die zu den Leitmedien der Gegenwart geworden sind. (…). Sie sind die Treibsätze einer Kultur, die sich immer mehr für das nächste große Ding interessiert, die Vergangenheit entwertet und dabei vor der Gegenwart nicht Halt macht.
Den Texten ist diese Bewegung auf das Nächste eingeschrieben. Die Beschränkung auf hundertvierzig Zeichen macht klar: Niemand will hier bei irgendetwas lange verweilen. Kann man auch gar nicht. Die nächsten Tweets werden in der Timeline längst weiter draufgestapelt.
Ein Tweet (…) markiert nicht das Ende. Er ist das Material für die nächsten Ideen.“ - S. Porombka, Die nächste Literatur. Anmerkungen zum Twittern.
Die Übung ‘Experimentelles Schreiben‘ bietet die Möglichkeit, von der Rolle der Analysierenden hinüberzuwechseln in die Rolle der text-produzierenden ‚KünstlerInnen‘: unter Anleitung werden eigene, experimentelle Texte verfasst, vorgestellt und diskutiert.
Die selbständige literarische Arbeit liefert dem Gespür für die spezifische Machart von Texten neue Impulse. Aus praktischer Perspektive wird entdeckt „dass Gedichte, Romane oder Novellen keine spontanen, mehr oder weniger unüberlegten Einfälle eines Autors sind, sondern durchkomponierte Strukturen aufweisen.“ (Leis 2012, S. 7).
Neben der generellen Fähigkeit, sich auszudrücken, wird somit auch das Vertrauen in die eigene theoretisierende Einschätzung von Literatur gestärkt. Die Übung besteht aus drei Einheiten, wovon einige abends in Karlsruher Museen stattfinden
Bei der Darstellung seines Projekts bedient sich auch Blumenberg verschiedener, bestimmte Erwartungshorizonte eröffnender Metaphern. Damit konnte der ‚Paradigmen‘-Text selbst zur Erprobung seiner Methodik als Gegenstand metaphorologischer Analysen dienen. So untersuchte Dirk Mende das darin implizit zur Sprache kommende Verhältnis zwischen Begriffsgeschichte und Metaphorologie, Rüdiger Campe widmete sich der zentralen Bedeutung der ‚Halbzeugs‘-Metapher für das Umspringen des thematischen Interesses Blumenbergs von Technikphilosophie zu Rhetorik.
Ab 1971 weitet Blumenberg jedoch seinen Ansatz aus: die Metapher stellt ab den Anthropologischen Annäherungen an die Rhetorik nur noch einen Spezialfall unter weiteren Formen der "Unbegrifflichkeit" dar. Des Weiteren fokussiert sich Blumenberg nicht mehr auf die Genese von Begrifflichkeiten, nun deckt er die „rückwärtigen Verbindungen“ der Metapher zur Lebenswelt auf. Mit diesem Perspektivwechsel ändert sich nicht nur die Funktion der Metapher, auch die Metaphorik innerhalb der Theorie Blumenbergs wechselt.
Die Untersuchung der damit vorgenommenen Weichenstellungen steht bisher noch aus. Ich schlage daher eine Fortsetzung der oben genannten meta-metaphorologischen Analysen vor. Angewandt auf Blumenbergs 1979 veröffentlichten Ausblick auf eine Theorie der Unbegrifflichkeit, wird damit zunächst die spezifische Frage, was es war, was Blumenberg wissen wollte, beantwortet. Daran anschließend kann in die allgemeinere Diskussion übergegangen werden: Was kann es sein, was wir aufgrund der jeweils verwendeten Metaphoriken auch auf weiteren, kulturwissenschaftlichen Gebieten erfahren können?
As a result rethinking the way they raise money is critical for their survival. It requires that nonprofits become more innovative and strategic in the way they use visuals. Selling balloons does not work anymore... .
Kategoriale, generische und mediale Transgressionen in Ridley Scotts ‚Prometheus‘ als Arbeit am Mythos.
Die Urerzählung grenzüberschreitender Rebellion lässt sich seit der griechischen Antike im Prometheus-Mythos finden. Mit dem 2011 in die Kinos gekommenen Prequel zur Alien-Reihe fügt Ridley Scott der Tradierung dieses Stoffes ein weiteres Kapitel hinzu.
Gemäß der These des deutschen Philosophen Hans Blumenberg, dass Mythen Geschichten von hochgradiger Beständigkeit ihres narrativen Kerns und ebenso ausgeprägter marginaler Variationsfähigkeit seien, aktualisiert Scott mit einer solchen „Arbeit am Mythos“ die mit dem Stoff verbundenen, seit der griechischen Antike immer wieder ähnlich und doch immer wieder neu erzählten Welt- und Selbstbildentwürfe des westlichen Kulturkreises.
Erst einmal nur des Titels wegen steht Scott in einer Reihe mit Aischylos, Goethe, Shelley und vielen weiteren Kunstschaffenden - doch welche Elemente der Basiserzählung greift er tatsächlich auf? Wie variiert er sie und schafft daraus ein Zukunftsnarrativ mit einem neuen, für die Gegenwart bedeutsamen Interpretationsrahmen?
Der Film, als Machwerk zwischen tiefsinnigem Autorenfilm und effektbeladenem B-Movie in der Kritik stark umstritten, liefert zur Beantwortung dieser Fragen reichlich Potential.
Mein Beitrag arbeitet zunächst die im Film gezeigten kategorialen Grenzüberschreitungen zwischen Menschen und menschenerschaffenden Außerirdischen sowie ihrer algorithmischen Fesseln entbundenen Androiden heraus, verortet diese dann historisch und schließt mit einer, der Analyse gefundener Transgressionen folgenden Interpretation.