Papers by Bernward Grünewald
Zur moralphilosophischen Funktion des Prinzips vom höchsten Gut, 1993
This article tries to elucidate the moral significance of the principle of the highest good apart... more This article tries to elucidate the moral significance of the principle of the highest good apart from (and before) its ethico-theological function in the moral argument for the existence of God.
Akten des XI. Kant-Kongresses 2010, 2000
Philosophischer Literaturanzeiger, 2016
Erfahrung und Denken, 2009
Philosophischer Literaturanzeiger, 2016
Phänomenologie statt Lebensphilosophie., 1988
This article reveals that the phenomenology of Husserl has provided quite a set of concepts to ma... more This article reveals that the phenomenology of Husserl has provided quite a set of concepts to make the Diltheyan project of a foundation of the “human sciences” a theoretically serious enterprise. To make this clear one has to consider the ambition of Dilthey together with the phenomenological concepts under the perspective of the Kantian transcendental philosophy.
Der Kongressbeitrag soll zeigen, dass Husserls Phänomenologie eine ganze Reihe von Begriffen bereitgestellt hat um das Diltheysche Projekt der Begründung der Geisteswissen-schaften zu einer theoretisch weiterführenden Unternehmen zu machen. Um dies deutlich zu machen, muss man die Zielsetzungen Diltheys zusammen mit den phänomenologi-schen Konzepten unter der Perspektive der Kantischen Transzendentalphilosophie be-trachten.

Zu der Neuausgabe von Hans Wagners Philosophie und Reflexion, 2013
I Hans Wagners erstes Hauptwerk Philosophie und Reflexion ist das Ergebnis einer längeren Entwick... more I Hans Wagners erstes Hauptwerk Philosophie und Reflexion ist das Ergebnis einer längeren Entwicklung seines Denkens.-Die akademischen Lehrer, die Wagner während seines Studiums gehört hat, scheinen ihn nicht nach-haltig beeindruckt zu haben, seinen philosophischen Werdegang charakte-risierte er später einmal so: "Als der systematische Autodidakt, der ich war, hatte ich seit meinen Studentenjahren viel und vielerlei gelesen, ohne Rücksichten auf Schulzusammenhänge, ohne die Vorteile, ohne die Nach-teile von Schulzusammenhängen, frei in meiner Wahl und in meiner Wert-schätzung." 1 Ein erstes Zeugnis dieser systematischen Unabhängigkeit war schon die Doktordissertation, in der Wagner sich Rechenschaft zu geben suchte über Recht und Unrecht der philosophischen Entwicklung zwi-schen den beiden Weltkriegen. Er hatte "allem ‚Nachlassen des Interesses am Apriorismus zum Trotz' den Idealismus der Marburger Transzendenta-listen wie der südwestdeutschen Werttheoretiker und schließlich die stren-ge Phänomenologie noch einmal ernst genommen und war so in die mäch-tig hochgehenden Wogen des biologisch-naturalistischen Denkens hinein-gesprungen" 2 , um sich einen eigenen prinzipientheoretischen Standpunkt zu erarbeiten. So gründlich Wagner in seiner Dissertation die neukantianischen und die phänomenologischen Bewußtseins-und Subjektstheorien durcharbeitet, um das Problem der Möglichkeit erfahrungsunabhängiger Erkenntnis, der Erkenntnis a priori, zu lösen-den Schlüssel zur Lösung findet er zunächst noch in der ontologischen Erkenntnislehre Nicolai Hartmanns, der selbst eine Entwicklung vom ‚Idealismus' der Marburger (Cohen und Natorp) zum ‚Realismus' seiner "Metaphysik der Erkenntnis" 3 durchgemacht hatte. Hartmann hatte der Logizismus der Marburger nicht genügt, weil dieser s. E. der vom Begriff der Erkenntnis geforderten Unabhängigkeit des Er-1 Bei der Ansprache zum 65. Geburtstag von Wolfgang Cramer am 18.10.1966 (der Text der Ansprache wird im Band 6 unserer Ausgabe veröffentlicht werden). 2 Wir zitieren aus dem Vorwort zum separaten Sonderdruck der Dissertation Apriorität und Idealität. Vom ontologischen Moment in der apriorischen Erkenntnis, Fulda 1947), S. 1; die Arbeit erschien zugleich (ohne das Vorwort) im Philosophischen Jahrbuch, Bd. 47, S. 297-361 u. 431-496 (wir zitieren im Folgenden den Separatdruck, Seitenzahlen der Zeit-schrift in eckigen Klammern). 3 Nicolai Hartmann, Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, 2., ergänzte Aufl., Berlin 1925; diese zweite Auflage enthält die Ergänzung um jene Theorie des idealen Seins, an die Wagner sich in der Dissertation anschließt.
Das Theoretische, das Praktische und das Sittengesetz. Zu Husserls Kritik der Kantischen Moralphilosophie., 2014
Analyse der Rezeption der Kantischen Moralphilosophie durch Edmund Husserl, in der gezeigt wird, ... more Analyse der Rezeption der Kantischen Moralphilosophie durch Edmund Husserl, in der gezeigt wird, dass Husserl das Prinzip der Kantischen Moralphilosophie nicht verstanden hat und dass er selbst nicht in der Lage ist, ein Kriterium moralisch richtigen Handelns zu entwickeln.
Ontologie der Freiheit?, 2017
Der Aufsatz ist eine Analyse der beiden Ansätze zu einer Freiheitstheorie bei dem Transzendentalp... more Der Aufsatz ist eine Analyse der beiden Ansätze zu einer Freiheitstheorie bei dem Transzendentalphilosophen Hans Wagner: einerseits eine 'realontologische' Theorie der relativen geistigen Freiheit des Menschen und andererseits einer subjektsontologische Theorie unbedingter Freiheit unter der Idee der praktischen Geltung.

Kant und die Grundlegung der Geisteswissenschaften, 2013
Die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung gelten für die empirischen Geisteswissenschaften ni... more Die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung gelten für die empirischen Geisteswissenschaften nicht weniger als für die Naturwissenschaften. Kant jedoch ist der Überzeugung, dass es zwar eine Lehre, aber keine Wissenschaft von der ‚denkenden Natur‘ geben könne, denn die denkende Natur sei als Gegenstand des inneren Sinnes durch nichts anderes als die eindimensionale Zeit strukturiert, die keine mathematische Konstruktion des Begriffs der denkenden Natur erlaube. Aber der menschliche Wille, als ‚Naturursache in der Welt‘, ist nach Kant ein ‚Begehrungsvermögen nach Begriffen‘. Und erfahrbar ist das Denken nur, insofern es von Natur ein ‚Sprechen zu und von sich selbst‘ ist und also verstehend rezipiert werden kann. Warum also sollte es nicht eine Mathematik der Gedanken und dann auch Metaphysischen Anfangsgründe einer Wissenschaft von der denkenden Natur geben?
Form und Materie der reinen praktischen Vernunft I Form und Materie der reinen praktischen Vernun... more Form und Materie der reinen praktischen Vernunft I Form und Materie der reinen praktischen Vernunft Über die Haltlosigkeit von Formalismus-und Solipsismus-Vorwürfen und das Verhältnis des kategorischen Imperativs zu seinen Erläuterungsformeln Bernward Grünewald, Köln
La première partie de cet article analyse les propositions centrales de la pragmatique transcenda... more La première partie de cet article analyse les propositions centrales de la pragmatique transcendantale pour la justification des normes; ces propositions reposent sur l'affirmation de l'« incontournabilité » de la situation d'argumentation. On y discute cette « incontournabilité ». La deuxième partie cherche à corriger la position du problème tout en conservant les avantages de la conception pragmatique transcendantale. On y remplace la situation d'argumentation par un acte vraiment « incontournable », à savoir notre conscience pratique (ou notre vouloir en général), qui révèle la volonté générale comme condition de possibilité de cette conscience pratique.

Es ist kein geringer Vorzug einer philosophischen Position, wenn sie Probleme aus ganz verschiede... more Es ist kein geringer Vorzug einer philosophischen Position, wenn sie Probleme aus ganz verschiedenen philosophischen Traditionen aufgreift und vorher nie zusammen gedachte theoretische Ansätze zur Beantwortung einer systematischen Frage vereinigt. Die von Hans Apel und seinem Schüler Wolfgang Kuhlmann 1 in enger, auch theoretischer Nachbarschaft zu Jürgen Habermas entwickelte ›Transzendentalpragmatik‹ hat sich (neben dem Rückgriff auf den amerikanischen Pragmatismus, die deutsche Kulturanthropologie und die Frankfurter Schule) eine systematische Vereinigung von Ansätzen der klassischen Transzendentalphilosophie und der modernen Sprechakttheorie zum Programm gemacht. Ihr vordringliches Ziel ist die Letztbegründung theoretischer und praktischer Prinzipien gegen die skeptischen Einwände etwa der ›kritischen Rationalis-ten‹ und gegen die Befürchtung, die ›linguistische Wende‹ verdamme uns z. B. in der praktischen Philosophie dazu, uns auf eine pure Meta-Ethik zu beschränken.
The Paper shows that Kant in his "Metaphysical Foundations of Natural Science" uses a modal syste... more The Paper shows that Kant in his "Metaphysical Foundations of Natural Science" uses a modal system quite different from the system used in the "Critique of Pure Reason". Being much more apt to the objectivity founding task of the categories this different modal system gives occasion to reformulate the modal principles of the "Critique of Pure Reason".
Jahrbuch für Recht und Ethik / Annual Review of Law and Ethics, 1995
The paper analyses the utilitarianism of Peter Singer showing the contradiction between its stric... more The paper analyses the utilitarianism of Peter Singer showing the contradiction between its strictly objectivistic relying on the validation of interests and its inevitable moral demand, exclusively made on human subjects. The paper argues that moral demands imply the concept of right of those who are the addressees of the demands and that this constitutes a fundamental moral difference between humans and non-humans, a difference denied by Singer.
This contribution tries to show that it is possible to take serious the Kantian considerations of... more This contribution tries to show that it is possible to take serious the Kantian considerations of the problem of veracity without sharing the conclusions in his essay "On a Supposed Right to Tell Lies from Benevolent Motives". After analysing the arguments of two recent attempts to defend the position of the Kantian essay against Constant, the question will be examined if in the situation outlined by Constant and Kant the conditions for lying are really fulfilled. It will be shown that, according to the logic of the situation, neither the murderer can rely on the veracity of the asked person nor can the latter rely on the trust of the murderer in his, the asked person's, veracity; and that instead an attempt to outwit one another takes place, which is neither concerned by Kant's argument nor forbidden by the categorical imperative.

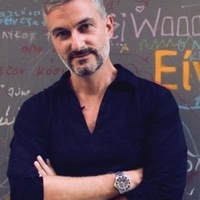









Uploads
Papers by Bernward Grünewald
Der Kongressbeitrag soll zeigen, dass Husserls Phänomenologie eine ganze Reihe von Begriffen bereitgestellt hat um das Diltheysche Projekt der Begründung der Geisteswissen-schaften zu einer theoretisch weiterführenden Unternehmen zu machen. Um dies deutlich zu machen, muss man die Zielsetzungen Diltheys zusammen mit den phänomenologi-schen Konzepten unter der Perspektive der Kantischen Transzendentalphilosophie be-trachten.
Der Kongressbeitrag soll zeigen, dass Husserls Phänomenologie eine ganze Reihe von Begriffen bereitgestellt hat um das Diltheysche Projekt der Begründung der Geisteswissen-schaften zu einer theoretisch weiterführenden Unternehmen zu machen. Um dies deutlich zu machen, muss man die Zielsetzungen Diltheys zusammen mit den phänomenologi-schen Konzepten unter der Perspektive der Kantischen Transzendentalphilosophie be-trachten.